Kleiderfirmen, Politikerinnen und Schweizer Städte tüfteln an Massnahmen gegen die Textilienberge. Braucht es Verbote, Steuern – oder setzt sich eine revolutionäre Idee durch?
Immer grössere Mengen an Altkleidern stapeln sich in den Lagern in der Schweiz und in Europa. Schweizer Bekleidungsunternehmen streben einen vorgezogenen Recyclingbeitrag auf Kleider an, Tell-Tex plant eine grosse Recyclinganlage für Baumwolltextilien. Die grüne Fraktionschefin fordert ein Schweizer Anti-Fast-Fashion-Gesetz.
Die Bluse war ein klassischer Fehlkauf: Nachdem sie zwei Jahre lang ungetragen im Schrank gehangen hat, kommt sie in den Altkleidersack. Dort landen auch die Kinderjacke mit dem kaputten Reissverschluss und die Jeans mit dem Rotweinfleck.
So oder ähnlich sieht es aus, wenn Schweizer Haushalte ihre Kleiderschränke ausmisten. Die Sammelfirmen wissen längst nicht mehr, wohin mit der Ware. Hersteller, Gemeinden und die Politik ringen um Lösungen. Wo jetzt Bewegung in die Sache kommt – und wo es hakt.
Recycling ist das Gebot der Stunde
Was vielen Menschen nicht bewusst ist: Die kaputte Jacke und die fleckige Jeans dürften heute gar nicht in den Altkleidersack. Sammelfirmen wollen nur, was sauber und in einwandfreiem Zustand ist. Das ganze System ist auf das Prinzip «Re-Use» ausgerichtet – also darauf, die Kleidung weiter zu tragen.
Genügen Textilien diesen Ansprüchen nicht, werden sie zu Putzlappen oder Dämmmaterial verarbeitet – oder verbrannt. Zu neuen Kleidern werden sie bisher kaum. Doch das soll sich ändern.
Einen Anfang macht die Stadt Zürich: Sie stellt ihre Altkleiderlogistik ganz neu auf. Statt dass die Textilien wie bisher im grossen Stil ins Ausland gebracht werden, wo sie im schlimmsten Fall auf Deponien landen, sollen sie ab 2027 möglichst im Inland sortiert und recycelt werden – auch wenn sie kaputt sind. Sammeln will die Stadt künftig selber.

Auch Basel prüft derzeit, wie es mit der Altkleidersammlung weitergehen soll. Timo Weber vom zuständigen Amt für Umwelt und Energie sagt, man befinde sich im Austausch mit Zürich – das Konzept sei spannend. Im Berner Stadtrat ist ebenfalls ein Postulat hängig, das auf eine lokale Verwertung von Altkleidern abzielt.
Auch Isabelle Baudin hofft, dass andere Gemeinden von Zürichs Erfahrungen lernen können. Sie ist Projektleiterin beim Schweizerischen Verband Kommunale Infrastruktur (SVKI) und sagt: «Allen ist klar, dass es nicht mehr weitergehen kann wie bisher.»
Die Zeiten, in denen eine Altkleiderspende primär eine gute Tat war, seien vorbei. «Weil die Qualität der Textilprodukte stark abgenommen hat und unsere Altkleider im Ausland kaum mehr gebraucht werden, handelt es sich plötzlich um einen gewöhnlichen Abfallstrom.» Nun gelte es einen Weg zu finden, wie Kleider und andere Textilien der lokalen Wiederverwendung und dem Recycling zugeführt werden können.
In den kommenden Wochen fänden mehrere Sitzungen mit Vertretern von Gemeinden, der Branche und den Sammelfirmen dazu statt.
Die grossen Pläne von Tell-Tex
Am äussersten Zipfel der Schweiz, in St. Margarethen im Rheintal, soll sich eine kleine Revolution abspielen. Hier will die Textilsammelfirma
Tell-Tex die schweizweit erste Anlage für industrielles Textilrecycling
bauen.
Künftig sollen Maschinen hier Baumwollkleider in kleine Teile zerlegen, Knöpfe entfernen und die Stoffe dann zu einzelnen Fasern zerkleinern, damit daraus neues Garn gesponnen werden kann. Faser-zu-Faser-Recycling heisst das im Jargon.
Ursprünglich sollte die Anlage bereits Anfang 2026 in Betrieb gehen. Wie Gespräche zeigen, ist das aber nicht realistisch. Wo der 9400 Quadratmeter grosse Recyclingpalast gebaut werden soll, steht heute erst ein blanker Betonboden.
Grund dafür seien unter anderem Unsicherheiten bei der Finanzierung, sagt Sascha Sardella, Betriebsleiter von Tell-Tex. Rund 40 Millionen Franken dürfte der Bau kosten. «Wir wollten kein Werk aufstellen, das wir nicht auslasten können.»
Zwar will die Stadt Zürich künftig auf die Anlage setzen. Auch mehrere Firmen zeigen sich laut Sardella interessiert, spruchreif sei aber noch nichts. Noch diesen Monat will Tell-Tex beim Bund ein Gesuch für finanzielle Förderbeiträge einreichen.

Unsicher ist plötzlich auch, ob die gross angekündigte Anlage überhaupt in St. Margarethen gebaut wird. Wegen der Zusicherung aus Zürich überlege man auch, näher an Zürich zu bauen, sagt Sardella.
Klar ist: Mit dieser Anlage allein ist es nicht getan. Einerseits kann sie nur 100-prozentige Baumwolle verarbeiten. Andererseits bräuchte es wohl noch viel mehr Anlagen wie diese, um die enormen Mengen an Alttextilien in der Schweiz bewältigen zu können.
Am Ende läuft alles auf die Frage hinaus: Wer soll das bezahlen?
Beitrag fürs Recycling auf den Kleiderkauf
Ein Lösungsvorschlag kommt aus der Schweizer Textilbranche: Sieben Unternehmen haben vor einem Jahr gemeinsam den Verein Fabric Loop gegründet, der sich für einen vorgezogenen Recyclingbeitrag einsetzt.
Das heisst: Konsumenten sollen für jedes neue Kleidungsstück ein paar Rappen mehr bezahlen. Aus den Einnahmen sollen dann die Sammlung, die Sortierung und das Recycling finanziert werden. Ein ähnliches System gibt es bereits bei PET-Flaschen.
Inzwischen sind rund ein Dutzend Bekleidungsunternehmen dabei, darunter Mammut, PKZ und Calida. Damit Fabric Loop sein Ziel erreicht, muss die Zahl aber noch deutlich wachsen. Erst wenn sich mindestens die Hälfte der inländischen Marktteilnehmer zur Lösung bekennen, kann der Bund sie für alle Hersteller für verbindlich erklären.
Fabric-Loop-Präsidentin Nina Bachmann sagt, das sei nötig: «Das System funktioniert nur, wenn es für alle gilt – auch für ausländische Anbieter wie Temu oder Shein.» Beim Bund befürwortet man das Vorhaben von Fabric Loop, wie es auf Anfrage heisst.
Fabric Loop peilt eine Einführung 2027 an – doch auch hier könnte es aufgrund offener Fragen zu Verzögerungen kommen.

Ruf nach Gesetz gegen Fast Fashion
Die Europäische Union ist schon einen Schritt weiter. Bis in zwei Jahren müssen sich dort alle Textilhersteller an den Kosten für die Wiederverwendung von Textilien beteiligen.
Das französische Parlament arbeitet zusätzlich an einem Anti-Fast-Fashion-Gesetz. Dieses sieht vor, dass die Abgabe auf ein Kleidungsstück umso höher ausfällt, je schlechter dieses für die Umwelt ist.
Auch ein Werbeverbot für Ultra Fast Fashion ist vorgesehen: Anbieter wie Temu und Shein dürften künftig in Frankreich nicht mehr für ihre Produkte werben. Bereits heute kann die französische Bevölkerung kaputte Schuhe und Kleider bei lizenzierten Shops vergünstigt reparieren lassen.
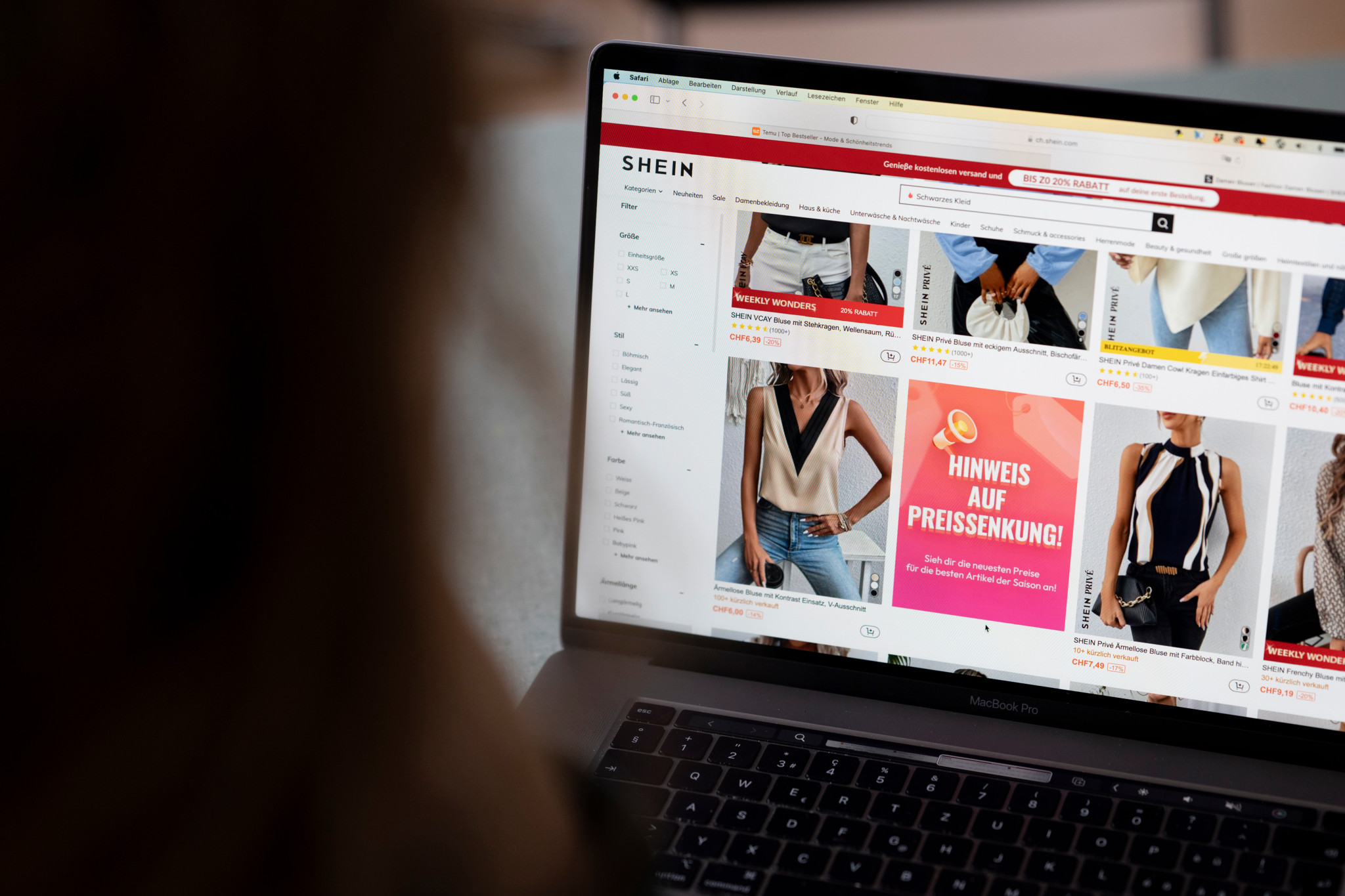
Ein Anti-Fast-Fashion-Gesetz wünscht sich die grüne Fraktionschefin Aline Trede auch für die Schweiz. In der Wintersession will sie eine Motion einreichen, die ein ganzes Bündel an Massnahmen verlangt.
Geht es nach Trede, müsste für Kleidung künftig eine Garantie gelten – ähnlich wie bei Elektrogeräten. «Wenn die Naht nach zweimal waschen aufgeht, müsste der Hersteller das T-Shirt zurücknehmen und es kostenlos reparieren.»
Trede will, dass der Staat – und nicht die Branche – eine Lenkungsabgabe erhebt und bestimmt, was damit geschieht. Zentral sei, dass die Abgaben auf minderwertige Produkte höher ausfalle als auf langlebige.
Ähnliche Forderungen erhob unlängst auch die Organisation Public Eye. Anfang Oktober reichte sie bei der Bundeskanzlei
eine Petition mit knapp 35’000 Unterschriften
ein.
Braucht es den Staat in der Altkleiderkrise?
Zur Idee eines staatlichen Modefonds hatte sich der Bundesrat bereits abschlägig geäussert. Eine solche Lösung wolle man nur ins Auge fassen, falls das freiwillige Modell der Branche scheitere, schrieb er in seiner Antwort auf einen Vorstoss der Grünen Sophie Gigon (VD).
Gegen eine staatliche Lösung stellt sich auch Regine Sauter. Die Zürcher FDP-Nationalrätin ist Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Textilwirtschaft und sagt: «Die Branche hat das Problem längst erkannt und arbeitet in hohem Tempo an einer Lösung.» Die Hersteller wüssten besser als der Staat, wie die Kreisläufe sinnvoll geschlossen werden könnten.
Unnötig findet die Freisinnige Versuche, die Konsumenten zu erziehen. «Wenn Leute unbedingt ein chinesisches T-Shirt für 3 Franken kaufen wollen, ist das ihre Sache, solange für alle Händler die gleichen Regeln gelten.» Eine gesellschaftliche Diskussion sei aber begrüssenswert. Sie habe zu Hause noch gelernt, «dass man Kleider zuerst flicken lässt, bevor man etwas Neues kauft».
Bei Fabric Loop heisst es, eine Abstufung nach Umweltbelastung sei bei der Branchenlösung ebenfalls angedacht. Auch die Reparatur von defekter Kleidung solle gefördert werden. Die Details seien allerdings noch nicht spruchreif.
Starten Sie jeden Tag informiert in den Tag mit unserem Newsletter Guten Morgen. Melden Sie sich
hier
an.



