Was unterscheidet innovative Geno-Banken von trägen und welche Rolle spielen Kultur, Kunden und Netzwerke? Im Buch „Innovationsfähigkeit der Finanzbranche“ zeigen Jennifer Leger und Esther Bollhöfer Erfolgsfaktoren und Hindernisse für Genossenschaftsbanken.
Die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen ist als Bestandteil einer Karriere in Zeiten der Veränderung allgemein akzeptiert. Dass „Lesen bildet“ weiß schon der Volksmund. Obwohl wir alle tagtäglich viel zu viel lesen „müssen“, lesen wir wohl alle gleichzeitig auch viel zu wenig. Im Bank Blog finden Sie daher Hinweise und Empfehlungen auf interessante Bücher, die Ihnen neue Erkenntnisse und Ideen vermitteln sollen.
Genossenschaftsbanken galten lange als Bollwerke der Stabilität – regional verankert, sicherheitsorientiert und mit wenig Innovationsdruck. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die zunehmende Digitalisierung, das Erstarken von FinTechs, regulatorische Anforderungen und sich wandelnde Kundenerwartungen machen auch vor den traditionsreichen Instituten nicht halt.
In diesem Umfeld beleuchten Jennifer Leger und Esther Bollhöfer in ihrem Buch zentrale Erfolgsfaktoren und Hemmnisse für Innovationsprozesse in Genossenschaftsbanken – und liefern fundierte, praxisnahe Erkenntnisse. Dazu haben Sie 15 Genossenschaftsbanken näher untersucht.
Digitalisierung und FinTechs setzen traditionelle Banken unter Druck
Die Autorinnen machen deutlich: Der Innovationsdruck auf Genossenschaftsbanken ist heute so hoch wie nie. Neue Wettbewerber wie FinTechs oder branchenfremde Anbieter drängen mit spezialisierten, agilen Geschäftsmodellen in den Markt. Während klassische Banken unter starker Regulierung leiden und ein breites Leistungsspektrum abdecken müssen, konzentrieren sich FinTechs auf lukrative Nischen.
Die Folge: Genossenschaftsbanken müssen sich bewegen – und das schnell. Nur wer bereit ist, sein Geschäftsmodell zu hinterfragen und sich konsequent weiterzuentwickeln, kann langfristig überleben.
Der Wandel beginnt mit der richtigen Kultur
Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung: Ohne eine innovationsfreundliche Kultur bleibt jede Strategie wirkungslos. Die Autorinnen zeigen, dass der Erfolg innovativer Banken maßgeblich von einer offenen Haltung gegenüber neuen Ideen, klarer Kommunikation und der aktiven Unterstützung durch das Top-Management abhängt.
Gerade die Rolle des Vorstands als Innovationstreiber erweist sich dabei als entscheidend. Innovation darf kein Randthema sein, sondern muss Teil der gelebten Unternehmenskultur werden.
Innovationsfähigkeit ist mehr als Technik
Innovation wird in vielen Banken noch zu sehr mit neuen Technologien gleichgesetzt. Das Buch zeigt jedoch, dass es verschiedene Innovationsformen gibt: von Produkt- und Prozessinnovationen über soziale Innovationen bis hin zu gänzlich neuen Geschäftsmodellen. Erfolgreiche Banken kombinieren diese gezielt – und betrachten Innovation nicht nur als technische Herausforderung, sondern als strategische Notwendigkeit.
Innovationseinheiten als Katalysator
Eine der wichtigsten Empfehlungen: Die Gründung eigenständiger Innovationseinheiten abseits des Tagesgeschäfts. Sie schaffen Freiräume für kreative Prozesse und ermöglichen eine fokussierte Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen. Die Autorinnen zeigen, dass gerade Banken mit solchen spezialisierten Teams signifikant häufiger echte Marktneuheiten – sogenannte „First-to-Market“-Innovationen – hervorbringen.
Erfolgsfaktor Netzwerk: Über den Tellerrand schauen
Auffällig ist, dass erfolgreiche Banken nicht nur innerhalb des genossenschaftlichen Verbunds nach Ideen suchen, sondern aktiv branchenfremde Netzwerke nutzen. Der Austausch mit externen Innovationsverantwortlichen, etwa aus der Start-up-Szene oder aus anderen Branchen, wirkt wie ein Innovationsbooster. Zudem zeigt sich, dass diese Institute häufig Mitarbeiter mit nicht-bankfachlichem Hintergrund in Innovationsprojekte einbinden – ein frischer Blick von außen hilft.
Kundenzentrierung als Innovationsprinzip
Ein weiterer zentraler Aspekt: Der Einbezug von Kunden in den Innovationsprozess. Die Autorinnen betonen, dass neue Produkte und Dienstleistungen nicht über die Köpfe der Kundschaft hinweg entwickelt werden dürfen. Erfolgreiche Banken beziehen ihre Kunden aktiv ein – zum Beispiel durch Interviews, Tests und Feedbackrunden – und verbessern so die Relevanz und Marktfähigkeit ihrer Angebote.
Typische Barrieren – und wie sie überwunden werden
Trotz aller Empfehlungen bleibt der Weg zur innovativen Bank steinig. Das Buch benennt die häufigsten Hindernisse:
- Fehlende strategische Verankerung: Innovation wird oft nicht als Teil der Unternehmensstrategie verstanden.
- Mangelnde Entscheidungskompetenz: Mitarbeitende können gute Ideen nicht eigenständig umsetzen.
- Abhängigkeiten im Verbund: Entscheidungen werden ausgebremst durch langwierige Abstimmungsprozesse.
- Regulatorische Hürden: Strikte Vorgaben erschweren schnelle Entwicklungen.
Die Autorinnen plädieren dafür, regulatorische Anforderungen zunächst bewusst auszuklammern – und sich in frühen Innovationsphasen gedanklich in die Lage von FinTechs zu versetzen, die deutlich freier agieren.
Innovationsfähigkeit unabhängig von Größe
Ein interessantes Ergebnis der Studie ist, dass die Größe einer Bank kein Garant für Innovationskraft ist. Entscheidend ist vielmehr die Größe und Qualität der Innovationsabteilung. Hier zeigt sich: Kleine Banken mit klar fokussierten Innovationsteams können ebenso erfolgreich sein wie große Institute – wenn sie klug organisiert und gut vernetzt sind.
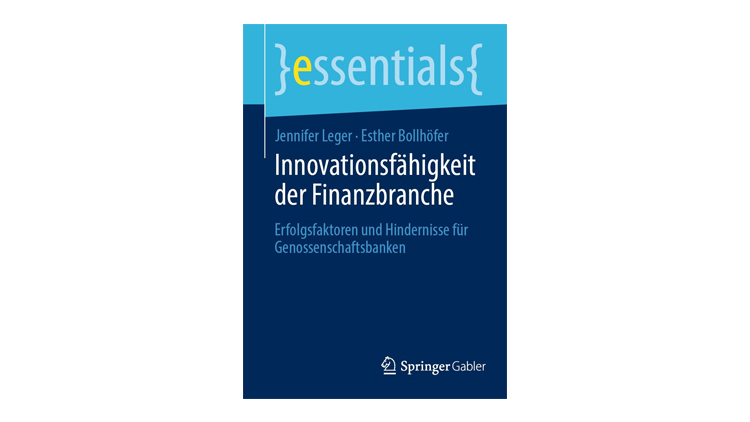
Innovationsfähigkeit entsteht dort, wo Strategie, Kultur und Kundenfokus zusammentreffen.
Handlungsempfehlungen für Entscheider
Zum Abschluss liefern Leger und Bollhöfer praxisnahe Empfehlungen für Banken, die ihre Innovationsfähigkeit gezielt ausbauen wollen. Dazu zählen:
- Gründung eigenständiger Innovationseinheiten mit klaren Zielen.
- Einbindung branchenfremder Expertise und externer Netzwerke.
- Entwicklung einer sichtbaren, gelebten Innovationsstrategie.
- Frühzeitige und direkte Einbeziehung von Kunden in Innovationsprozesse.
- Förderung einer offenen Innovationskultur auf allen Ebenen.
Fazit: Pflichtlektüre für Genossenschaftsbanken im Wandel
„Innovationsfähigkeit der Finanzbranche“ ist mehr als ein wissenschaftlicher Beitrag – es ist ein praxisnaher Wegweiser für Banken, die den Wandel aktiv gestalten wollen. Die Mischung aus empirischer Untersuchung, klarer Analyse und konkreten Handlungsempfehlungen macht das Werk besonders wertvoll. Für Führungskräfte, Innovationsmanager und Strategieverantwortliche in Genossenschaftsbanken bietet es einen kompakten Überblick über die wichtigsten Stellschrauben auf dem Weg zur innovativen Bank. Wer nicht nur reagieren, sondern aktiv gestalten will, findet hier wertvolle Impulse.
Über die Autoren Jennifer Leger und Esther Bollhöfer
Jennifer Leger ist Scrum Master beim IT-Dienstleister des Genossenschaftsverbunds Atruvia und war zuvor bei verschiedenen Genossenschaftsbanken tätig.
Prof. Dr. Esther Bollhöfer ist wiss. Leiterin des Kompetenzzentrums für Technologie- & Innovationsmanagement der FOM Hochschule für Oekonomie und Management. Sie lehrt und forscht seit mehr als 20 Jahren zu Innovationen im Dienstleistungssektor.
„Innovationsfähigkeit der Finanzbranche“ als Buch oder Zusammenfassung
Das Buch hat 50 Seiten. Sie erhalten es u.a. bei Amazon.
fünfseitigen Zusammenfassung als PDF oder für iPhone, Android oder Kindle optimiert. Die meisten Zusammenfassungen können Sie zudem als MP3 Datei zum Unterwegs hören herunterladen. Sie sparen Zeit bzw. können sich z.B. danach entscheiden, ob Sie das Buch auch als Ganzes lesen wollen.

